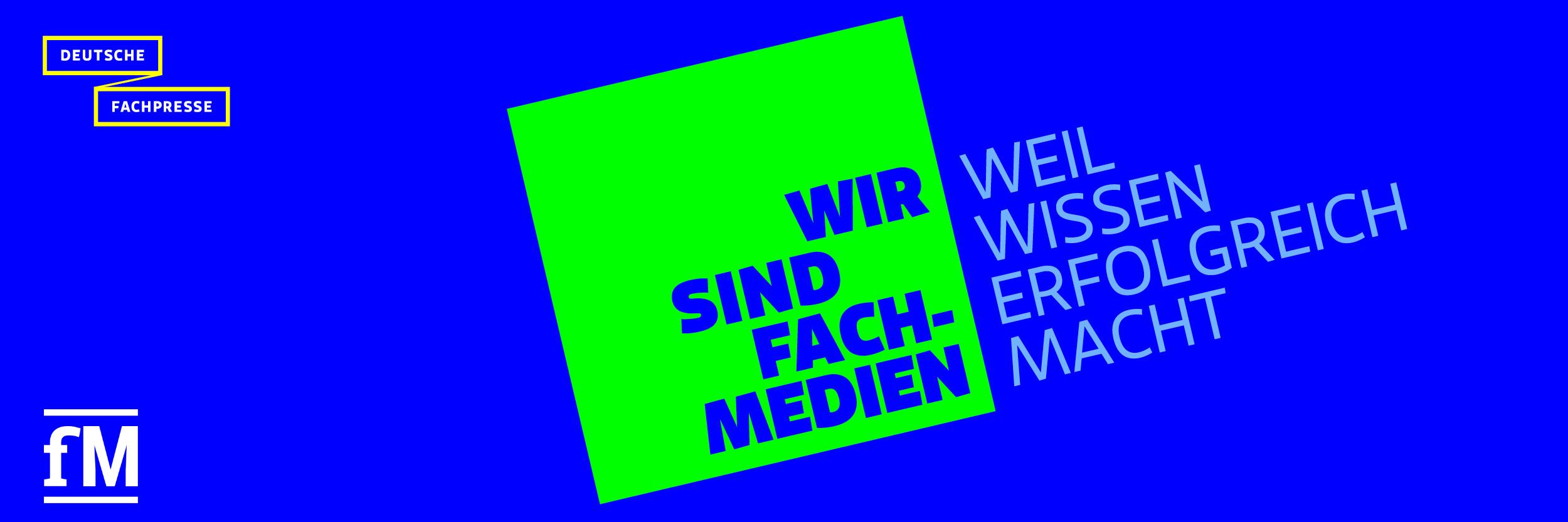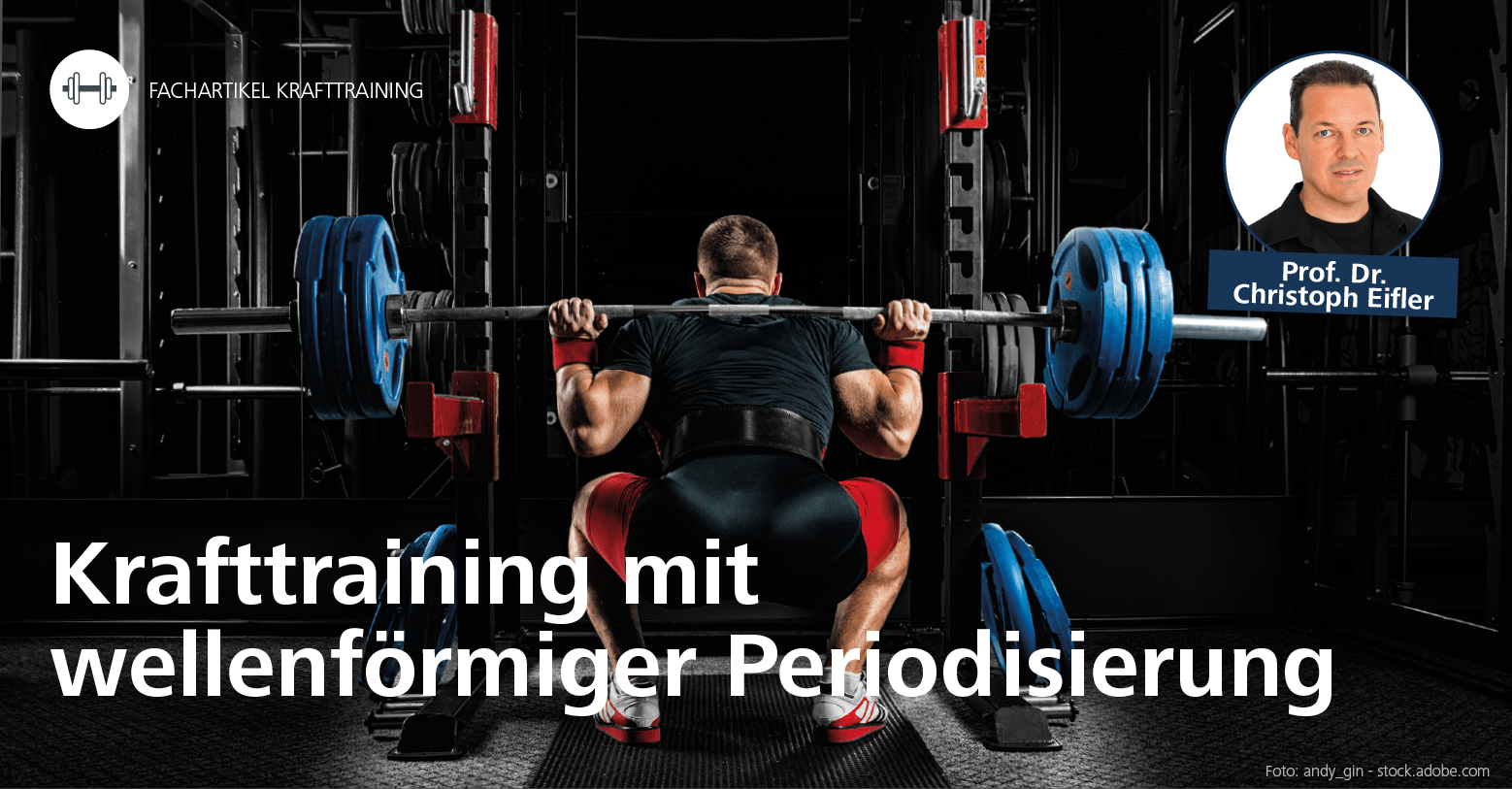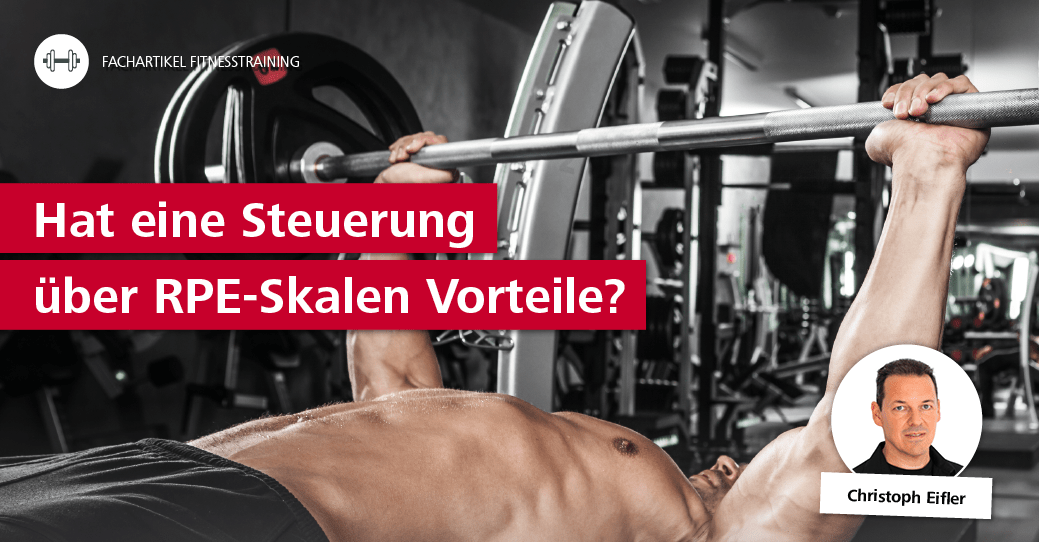Schon seit Jahrzehnten werden die Krafttrainingsmethoden in der trainingswissenschaftlichen Literatur über die Relation zwischen Belastungsintensität (Höhe der Trainingslast) und Belastungsdauer (Anzahl der Wiederholungen) definiert.
So existieren trennscharfe Differenzierungen zwischen einem Krafttraining zur Verbesserung der Ermüdungswiderstandsfähigkeit bei Kraftleistungen (Kraftausdauertraining) und einem Krafttraining zur Verbesserung der maximal möglichen Kraftleistung (Maximalkrafttraining). Kraftausdauer- und Maximalkrafttraining zielen auf die Verbesserung der funktionellen Kraftleistungsfähigkeit ab. Weniger trennscharf gestaltet sich jedoch die Definition eines Hypertrophietrainings.
Bei einem Hypertrophietraining geht es nicht um funktionelle, sondern primär um morphologische Anpassungen. In der trainingswissenschaftlichen Literatur wird ein Hypertrophietraining meistens als 'Hybrid' zwischen einem Kraftausdauer- und einem Maximalkrafttraining abgebildet (in der Regel in einem Bereich von 8–15 Wiederholungen bei einer Intensität von 70–85 % 1-RM).
Aus dieser klassischen Dreiteilung in Kraftausdauer-, Hypertrophie- und Maximalkrafttraining wurde früher geschlussfolgert, dass optimale Hypertrophieeffekte primär in dem oben genannten Intensitäts- und Wiederholungszahlbereich ausgelöst werden.
Seit Jahren ist aber bekannt, dass dieser klassische Ansatz für das Muskelaufbautraining in der Trainingspraxis nicht die optimale Lösung darstellt. Das zentrale Problem bei den Relationen zwischen Intensität (in % 1-RM) und zu realisierenden Wiederholungszahlen liegt darin, dass die Wiederholungszahlen in Abhängigkeit von Bewegung, Muskelgruppe, Leistungsstand und individueller Muskelfaserzusammensetzung bei identischer Intensität erheblich variieren können.
Zum Auslösen von Hypertrophieeffekten muss aus der Relation zwischen Belastungsintensität und Belastungsdauer über eine Serie eine möglichst hohe mechanische Muskelspannung resultieren, um die Muskelproteinsynthese anzuregen (Lim et al., 2022). Ob aus dem oben genannten klassischen Trainingsbereich für ein Hypertrophietraining bei jeder Übung und bei jeder Person ein hoher mechanischer Muskelstimulus erzielt wird, ist jedoch eher ein Zufallsprodukt aufgrund der hohen individuellen und übungsspezifischen Schwankungen.
Praxistipps
- Die Nutzung eines breiten Intensitätsspektrums ist möglich: Deine Trainierenden können Muskelaufbau in einem weiten Intensitätsbereich (ca. 30–90 % 1-RM) erreichen, solange eine hohe mechanische Spannung erzielt wird.
- Gehe bei einem umfangsorientierten Krafttraining nahe an die Ausbelastung: Bei einem umfangsorientierten Krafttraining müssen möglichst alle motorischen Einheiten nacheinander rekrutiert werden – das gelingt, wenn die Trainierenden nah an die muskuläre Ausbelastung gehen, ohne zwingend bis zum Muskelversagen zu trainieren.
- Vermeide unnötige Überlastungen: Deine Mitglieder müssen nicht in jedem Satz bis zum Muskelversagen trainieren – ein bis zwei Wiederholungen in Reserve vermeiden übermäßige Mikrotraumatisierungen und verbessern so die Netto-Muskelproteinbilanz.
- Passe Vorgaben individuell an: Gebe keine starren Wiederholungs- oder Intensitätsvorgaben vor. Berücksichtige stattdessen die individuellen Unterschiede und Vorlieben deiner Kunden.
Neue Überlegungen zum Muskelaufbautraining
Konträr zu dem oben dargestellten klassischen Trainingsansatz für ein Hypertrophietraining zeigt die aktuelle Forschungslage, dass Hypertrophieeffekte durch ein wesentlich breiteres Intensitätsspektrum (30–90 % 1-RM) ausgelöst werden können (z. B. Carvalho et al., 2022). Aus diesem breiten Intensitätsspektrum kann geschlussfolgert werden, dass nicht allein die Höhe der Intensität – entgegen der früher geltenden Lehrmeinung – den entscheidenden Faktor zur Auslösung von Hypertrophieeffekten darstellt (Schoenfeld, Grgic, van Every & Plotkin, 2021).
Viel wichtiger ist, dass über eine Serie eine möglichst hohe Muskelspannung in den Muskelzellen erzielt wird. Eine hohe Muskelspannung entsteht, wenn möglichst alle verfügbaren motorischen Einheiten in einer Serie rekrutiert werden.
Dabei spielt es keine Rolle, ob maximal viele motorische Einheiten entweder gleichzeitig oder zeitlich nacheinander zur Überwindung der Trainingslast rekrutiert werden. Es ist nicht erforderlich, dass eine hohe mechanische Spannung bereits ab der ersten Wiederholung in allen Muskelzellen gleichzeitig erzeugt wird.
Insofern besteht für das Muskelaufbautraining nicht die Notwendigkeit, generell mit hohen Lasten zu trainieren. Für die Auslösung von Hypertrophieeffekten ist es vielmehr von Bedeutung, dass am Ende einer Serie möglichst alle verfügbaren motorischen Einheiten rekrutiert wurden, um in möglichst allen Muskelzellen eine hohe Spannung zu erzielen (Schoenfeld, Grgic, van Every & Plotkin., 2021). Dieser Effekt ist auch mit niedrigen Trainingsintensitäten und höheren Wiederholungszahlen (klassisches Kraftausdauertraining) erzielbar.
Bei einem umfangsorientierten Krafttraining (geringe Belastungsintensität, hoher Belastungsumfang) werden zu Beginn eines Satzes nicht alle verfügbaren motorischen Einheiten zur Krafterzeugung rekrutiert. Bei fortschreitender Ermüdung sendet das zentrale Nervensystem immer höhere Innervationssignale aus, um die muskuläre Leistung durch Rekrutierung der nächstgrößeren motorischen Einheiten aufrechtzuerhalten.
Sofern eine Serie bis nahe an die Muskelausbelastung ausgeführt wird, können dementsprechend auch mit einem umfangsorientierten Krafttraining alle verfügbaren motorischen Einheiten rekrutiert und eine möglichst hohe Muskelspannung erzielt werden.
Letztendlich wissen wir heute, dass die Angaben zur Intensität und Wiederholungszahl für ein effektives Hypertrophietraining im Vergleich zum klassischen Ansatz wesentlich breiter ausgelegt werden können, sofern die genannten Anforderungen an die Reizkonfiguration erfüllt sind.
Training bis zur Muskelausbelastung?
Die oben beschriebenen Schwächen des klassischen Ansatzes zum Hypertrophietraining sind zumindest im leistungsorientierten Muskelaufbautraining schon seit Längerem bekannt. Dementsprechend wird in diesem Leistungsbereich die Trainingsintensität – unabhängig von deren Anteil am 1-RM – stets an den anvisierten Wiederholungszahlkorridor angepasst, um am Ende einer Serie möglichst eine Muskel-
ausbelastung oder sogar ein konzentrisches Muskelversagen zu erzielen.
Die Notwendigkeit der Muskelausbelastung wurde früher in der trainingswissenschaftlichen Literatur explizit ausgesprochen, um nicht nur eine möglichst hohe Muskelspannung, sondern darüber hinaus Mikrotraumen in den Muskelzellen der Arbeitsmuskulatur auszulösen. Dem lag die Annahme zugrunde, dass die Mikrotraumatisierung der Muskelzellen den zentralen hypertrophieauslösenden Faktor darstelle.
Hypertrophieeffekte resultieren primär aus einer hoher Muskelspannung.
Diese Lehrmeinung hat sich in den letzten Jahren verändert. In einer Übersichtsarbeit untersuchten Damas, Libardi und Ugrinowitsch (2018) den Einfluss von Mikrotraumatisierung der Muskelzellen und Muskelproteinsynthese auf die Auslösung einer Skelettmuskelhypertrophie durch Krafttraining. Sie stellten die These auf, dass die trainingsinduzierte Steigerung der Muskelproteinsynthese zu größeren Hypertrophieeffekten führt, wenn das Ausmaß der Mikrotraumatisierung der Muskelzellen minimal gehalten wird.
Darüber hinaus kamen sie zu dem Schluss, dass Krafttraining auch bei nicht feststellbarer Mikrotraumatisierung der Muskelzellen zu ähnlichen Hypertrophieeffekten führt wie ein Krafttraining mit verursachter Mikrotraumatisierung. Die Autoren schlussfolgerten, dass die trainingsinduzierte Steigerung der Skelettmuskelmasse unabhängig davon zu sein scheint, ob das Krafttraining eine Mikrotraumatisierung auf zellulärer Ebene erzeugt. Daher kann die Mikrotraumatisierung nicht als relevanter Auslöser der Skelettmuskelhypertrophie angesehen werden.
Lesetipp: Erfahre mehr zur Geschichte des Krafttrainings in der Reihe 'Die Historie der Fitnessbranche'.
Heute geht man von folgender These aus: Wichtig für Hypertrophieeffekte ist, dass durch eine adäquate Reizkonfiguration eine Steigerung der Muskelproteinsynthese erzielt wird. Gleichzeitig soll aber eine überproportionale Verstärkung der Proteindegradation (Proteinabbau) vermieden werden. Das Ziel besteht darin, überdauernd eine positive Netto-Muskelproteinbilanz zu erzielen.
Ein Krafttraining, das auf eine Mikrotraumatisierung der Muskelzellen ausgerichtet ist, kann eine positive Netto-Muskelproteinbilanz gefährden, da die zugeführten Proteine primär für Reparaturprozesse an den Muskelzellen und nicht direkt für Muskelaufbauprozesse verarbeitet werden.
Es gilt, eine Belastungskonfiguration umzusetzen, die in einer Serie zu einer Rekrutierung möglichst aller verfügbarer motorischer Einheiten und somit zu einer möglichst hohen Muskelspannung führt. Dabei soll eine Mikrotraumatisierung der Muskelzellen jedoch nicht provoziert werden.
Um dies zu erreichen, ist es notwendig, bis nahe an die Muskelausbelastung zu trainieren. Eine vollständige Muskelausbelastung im Sinne eines Wiederholungsmaximums (RM) ist jedoch nicht erforderlich.
Dies bestätigen Studienergebnisse von Refalo, Helms, Robinson, Hamilton und Fyfe (2024). Sie verglichen die Hypertrophieeffekte eines Krafttrainings bis zur Muskelausbelastung mit einem Krafttraining mit einer und zwei Wiederholungen Reserve bis zur Muskelausbelastung.
In dieser Studie waren die Hypertrophieeffekte annähernd gleich groß. Aus der Muskelausbelastung ergab sich kein Benefit. Ein Krafttraining bis zum konzentrischen Muskelversagen über das RM hinaus wird tendenziell sogar kontraproduktiv eingestuft, da Mikrotraumatisierungen nicht im Fokus der Belastungskonfiguration stehen sollten.
Fazit
Die Ansätze und Überzeugungen zum Hypertrophietraining haben sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt. So steht heute nicht mehr das Training nach starren Intensitäts- und Wiederholungszahlen im Fokus, sondern die Erzeugung hoher mechanischer Spannung und die Rekrutierung möglichst vieler motorischer Einheiten.
Entscheidend für erfolgreiches Hypertrophietraining ist daher nicht das Absolvieren einer bestimmten Wiederholungsanzahl, sondern das Training bis nahe an die Muskelausbelastung.
Auszug aus der Literaturliste
Damas, F., Libardi, C. A. & Ugrinowitsch, C. (2018). The development of skeletal muscle hypertrophy through resistance training: the role of muscle damage and muscle protein synthesis. European Journal of Applied Physiology, 118 (3), 485–500.
Refalo, M. C., Helms, E. R., Robinson, Z. P., Hamilton, D. L. & Fyfe, J. J. (2024). Similar muscle hypertrophy following eight weeks of resistance training to momentary muscular failure or with repetitions-in-reserve in resitance-trained individuals. Journal of Sports Science, 42 (1), 85–101.
Schoenfeld, B. J., Grgic, J., van Every, D. W. & Plotkin, D. L. (2021). Loading recomendations for muscle strength, hypertrophy, an local endurance: A re-examination of the repetition continuum. Sports (Basel, Switzerland), 9 (2).
Für eine vollständige Literaturliste kontaktiere uns bitte hier per Mail.
Diesen Artikel kannst du folgendermaßen zitieren:
Eifler, C. (2025). Krafttraining: alte Lehren, neue Ansätze. fitness MANAGEMENT international, 5 (181), 106–108.