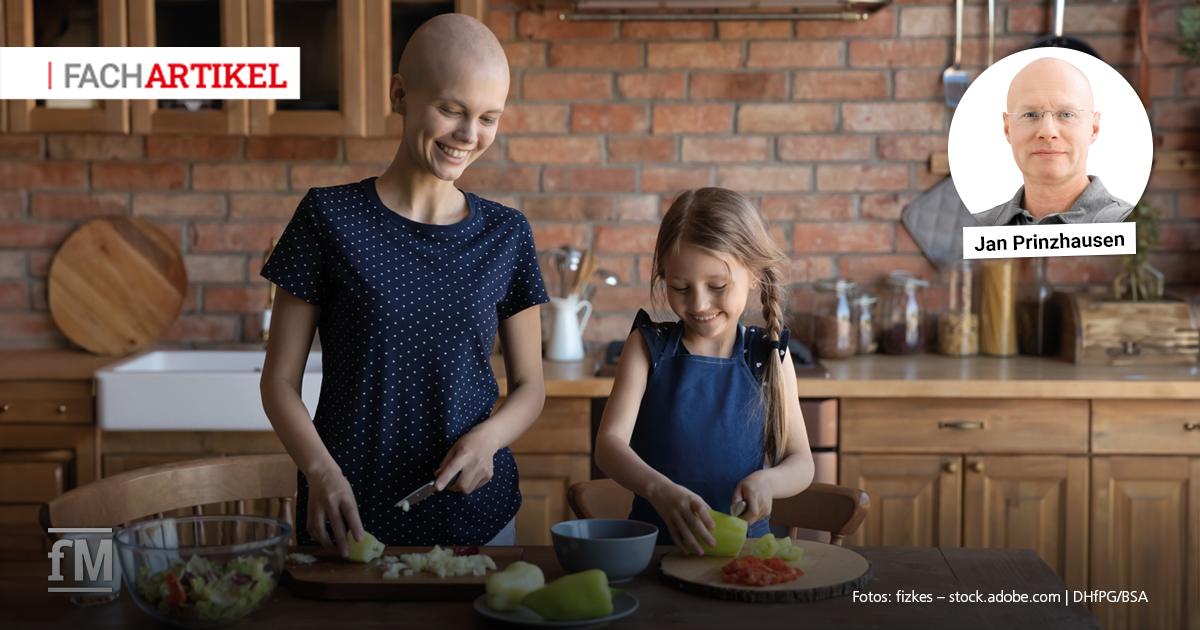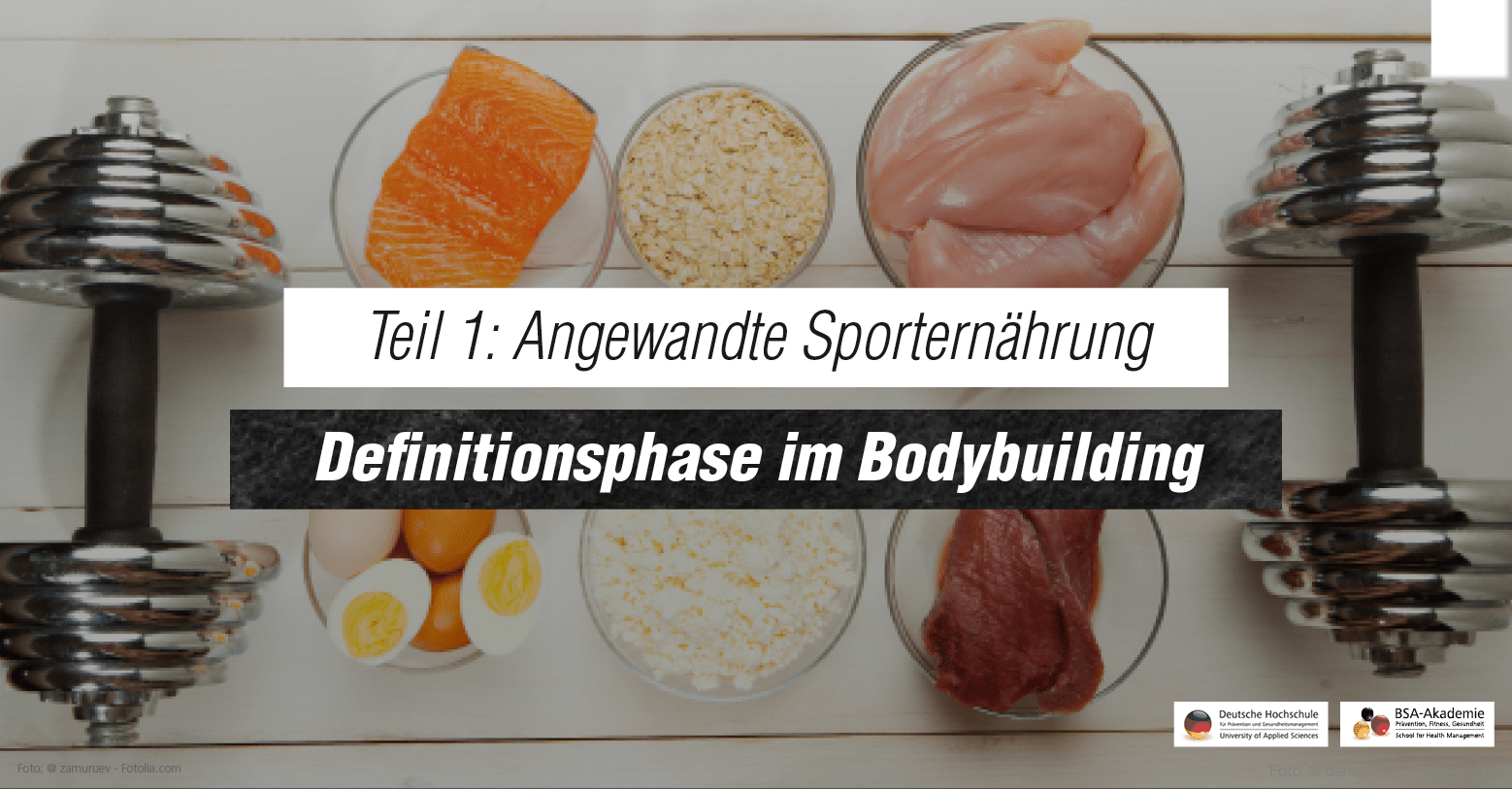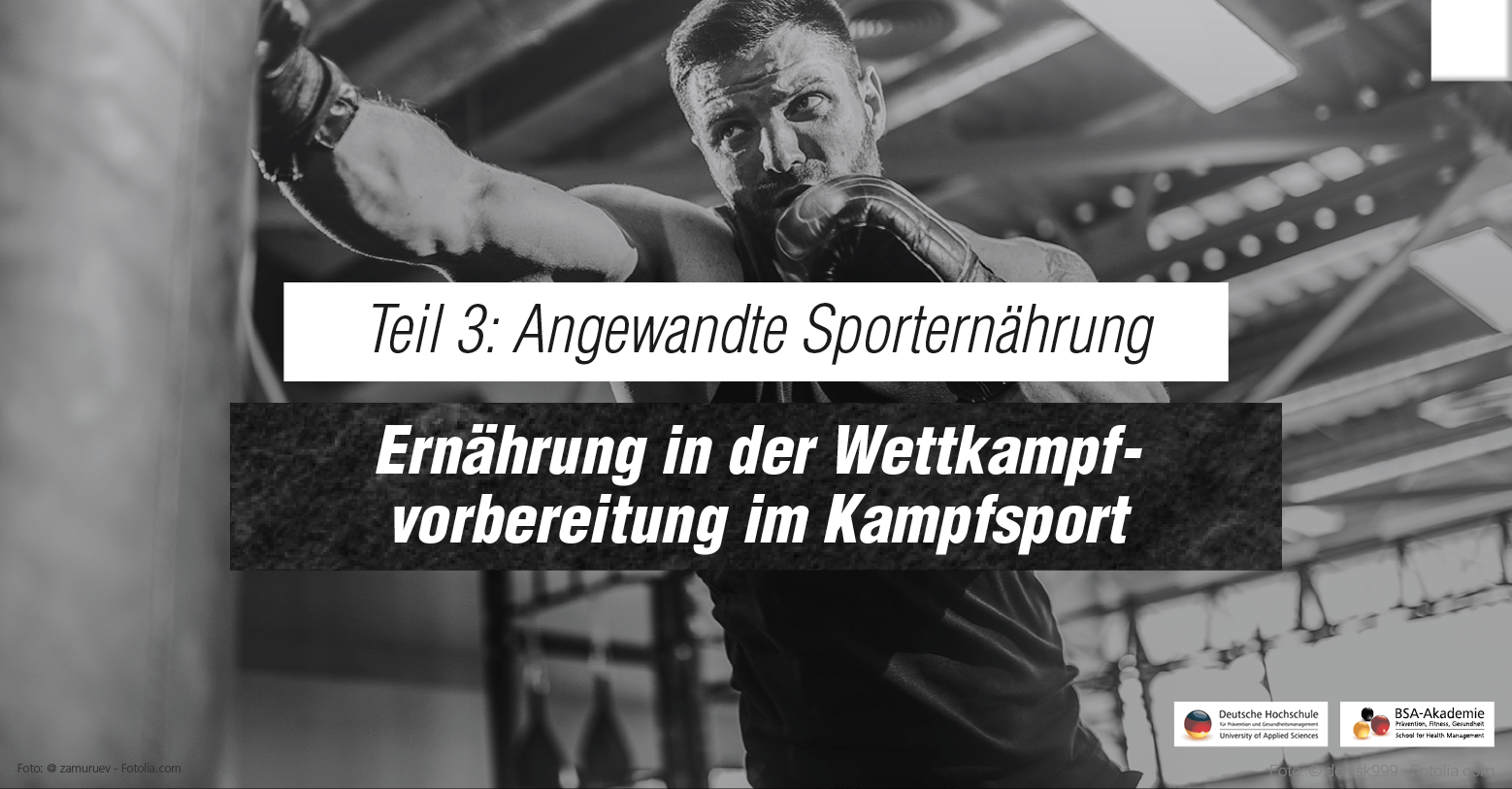Bei ca. 80 Prozent der bekannten Tumore lässt sich ein ausgeprägter anaerob-glykolytischer Stoffwechsel beobachten. Dieser basiert auf einem hohen Umsatz von Glucose und bedingt einen starken Anfall von Milchsäure. Große Mengen Glucose, deren Abbauprozess und das Endprodukt Milchsäure erweisen sich als vorteilhaft für die Krebszelle (Barrea et al., 2022; Lane et al., 2021).
Auf hohe Glucosespiegel im Blut reagiert der Körper mit der Bildung von Insulin und IGF-1. Beide Hormone aktivieren sogenannte Second-Messenger-Kaskaden mit anaboler Wirkung. Ein Ziel der Kaskaden ist z. B. die Hochregelung der Proteinbiosynthese. Diese anabole Stoffwechsellage hilft Krebszellen bei der Reifung und beim Wachstum.
Krebszellen profitieren vom anaerob-glykolytischen Stoffwechsel
Zudem ermöglicht der Umsatz von Glucose zu Milchsäure die größtmögliche ATP-Bereitstellung pro Zeiteinheit. Die Fähigkeit, Metastasen zu schieben, wird u. a. auf diese hohe Energieflussrate zurückgeführt (Barrea et al., 2022; Lane et al., 2021). Zwischenprodukte des Glucosestoffwechsels nutzt die Krebszelle für die Synthese von Amino-, Fett- und Nukleinsäuren. Die Krebszelle versorgt sich auf diese Weise mit Bau- und Funktionsstoffen, die das Fortschreiten der Pathogenese ermöglichen (Talib et al., 2021).
Die Protolyse der gebildeten Milchsäure mündet in eine metabolische Azidose. Sie hilft den Krebszellen, gesunde Körperzellen zu schwächen. Milchsäure verschafft den Krebszellen somit Überlebens- und Durchsetzungsvorteile (Lane et al., 2021).
Die ketogene Diät
Die klassische ketogene Ernährung liefert 90 Prozent der Energie aus Fett, 8 Prozent aus Protein und 2 Prozent aus Kohlenhydraten. Die untere Grenze beläuft sich auf 80 Prozent Fettenergie.
Das Verhältnis von Fett zu Kohlenhydraten bzw. zu Protein liegt bei vier zu eins und drei zu eins. Absolut beträgt die tägliche Kohlenhydratzufuhr maximal 50 Gramm. Die Bezeichnung „ketogen“ bezieht sich auf die gesteigerte Bildung von Ketonkörpern, die bei einer ketogenen Diät messbar ist (Lane et al., 2021; Talib et al., 2021; Weber et al., 2019).
Effekte auf den Tumorstoffwechsel
Die ketogene Diät limitiert den Tumor über die reduzierte Kohlenhydratverfügbarkeit und durch die gebildeten Ketonkörper. Der Senkung des Blutglucosespiegels folgt die verminderte Bildung von Insulin und IGF-1. Der anabole Reiz auf den Tumor wird abgeschwächt (Barrea et al., 2022; Weber et al., 2018, Weber et al., 2019). Parallel dazu geht die Aktivierung der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK) mit der Synthese von katabolen Tumorsuppressoren einher (Talib et al., 2021).
Krebszellen kennzeichnen sich oftmals durch eine gestörte Mitochondrienfunktion sowie den Mangel an lipo- und ketolytischen Enzymen. Sie können die Ketonkörper nur eingeschränkt oder gar nicht oxidieren. Die Fixierung auf die Glycolyse führt somit zu einem ATP-Defizit, wenn Glucose fehlt. Forscher sprechen vom „Aushungern“ der Krebszellen. Gesunde Körperzellen hingegen sind befähigt, die Ketonkörper zur Energiebereitstellung abzubauen (Barrea et al., 2022; Talib et al., 2021; Weber et al., 2018).
Entzündungsprozesse gelten als Ursachen für die Zellentartung und die Entwicklung von Tumoren. Der Ketonkörper Betahydroxybutyrat hemmt das Entzündungsgeschehen. Durch die Senkung der katalytischen Leistung der Cyclooxygenase-2 (COX-2) vermindert sich die Synthese von entzündungsfördernden Gewebshormonen aus der Omega-6-Fettsäure Arachidonsäure (Talib et al., 2021; Weber et al., 2019).
Die ketogene Ernährung hilft, Krebszellen „auszuhungern“
Als weitere Ursache bei der Krebsentstehung gilt oxidativer Stress. Dieser ist für Schäden an den Erbanlagen verantwortlich. Oxidativer Stress kann andererseits im Rahmen der Chemotherapie zur Bekämpfung von Krebs dienen. Dabei fungieren freie Radikale als Mittel zur Zerstörung von Tumorzellstrukturen. Verallgemeinert lässt sich feststellen, dass der Redoxhaushalt in Krebszellen gestört ist.
Dem liegen Funktionsveränderungen der Mitochondrien und des Glutathionsystems zugrunde. Unter ketogener Diät erfährt das Redoxsystem eine Rejustierung, gefolgt von der Ausbalancierung des Spiegels an freien Radikalen (Weber et al., 2019). Mit der Hemmung des nuclear factor kappaB (NF-kB) und der Aktivierung des Uncoupling Protein-2 (UCP2) lassen sich oxidativer Stress und die Schädigung der Mitochondrien vermeiden (Talib et al., 2021).
Es gibt weiterhin wichtige Schutzproteine. Diese Schutzproteine können u. a. den Lebenszyklus entarteter Zellen unterbrechen. Somit hemmen sie die Pathogenese von Tumoren. Mit der Umstellung auf ketogene Ernährung lässt sich durch einen Anstieg der Schutzproteine die Körperabwehr gegenüber Krebs verstärken (Weber et al., 2019).
Die Reduktion der Kohlenhydratverfügbarkeit soll helfen, die Pathogenese zu hemmen
Außerdem sezernieren Krebszellen Wachstumsfaktoren, welche die Blutgefäßbildung im Tumorgewebe fördern. Je mehr Gefäße vorhanden sind, desto effektiver können sich die Zellen mit Nährstoffen versorgen. Ketogene Ernährung bremst die Blutgefäßbildung und erschwert die Nährstoffversorgung des Tumors (Weber et al., 2019).
Die Effekte der Umstellung auf die ketogene Diät lassen sich auch auf epigenetischer Ebene nachweisen. Gezeigt werden konnte eine verstärkte Expression von Tumor-Suppressor-Genen. Im Resultat stehen dem Körper mehr Funktionsstoffe zur Abwehr der Tumorbildung zur Verfügung (Talib et al., 2021).
Kombination mit konservativer Therapie
Die ketogene Diät kann eine negative Energiebilanz bedingen. Einschließlich weiterer, bereits vorgestellter Aspekte lässt sich dadurch eine Sensitivierung der Krebszelle gegenüber der Chemotherapie beobachten (Weber et al., 2018).
Nach Talib et al. (2021) spielt bei der Effektivitätssteigerung der Chemotherapie auch die entzündungshemmende Wirkung ketogener Kost eine entscheidende Rolle. Zudem schützt die ketogene Ernährung, ähnlich dem Fasten, gesundes Körpergewebe vor der toxischen Wirkung der Chemotherapeutika (Plotti et al., 2020).
Risiken und Nebenwirkungen
Insgesamt betrachtet, zeigt sich die Anwendung der ketogenen Diät bei Krebspatienten als sicher (Lane et al., 2021; Zhao et al. 2022). Vorsicht ist bei Krebspatienten mit Kachexie geboten: Führt die ketogene Diät zu einer negativen Energiebilanz, geht Körpermasse verloren. Patienten, die von Kachexie betroffen sind, müssen daher zwingend auf eine ausgeglichene Energiezufuhr achten, um einen weiteren Gewebeverlust zu verhindern (Weber et al., 2018).
Zudem scheint die Effektivität der ketogenen Stoffwechsellage krebsartabhängig unterschiedlich zu sein. Insbesondere bei Melanomen und Nierenkrebs ließ sich im Tierversuch sogar eine Verstärkung der Kanzerogenese beobachten (Weber et al., 2018). In Einzelfällen zeigte sich eine Tumorprogression auch bei Krebspatienten, was zum Abbruch der Ernährungsumstellung führte (Weber et al., 2019).
In der Literatur werden Nebenwirkungen genannt, die bei der Umstellung auf die ketogene Diät auftreten können. Dazu zählen bei Krebspatienten Brechreiz, Erschöpfung, Benommenheit, Verstopfung, Gicht, Dehydration, Appetitverlust, Kopfschmerzen, Hyperlipidämien, Sehschwäche und Nährstoffdefizite (Weber et al., 2019).
Optimierung der ketogenen Diät
Die benannten Nebenwirkungen lassen sich bei bedarfsgerechter Ernährung und schrittweiser Reduktion der Kohlenhydratzufuhr abschwächen. Bei Defiziten kann das Supplementieren von Mikronährstoffen hilfreich sein (Weber et al. 2019). Zudem gibt es Hinweise, dass Ketonester, mittelkettige Triglyzeride, marine Omega-3-Fettsäuren, Quercetin und Curcumin den Gesundheitswert und die Effektivität der ketogenen Diät bei Krebs fördern können (Talib et al., 2021; Weber et al., 2018; Weber et al., 2019).
Es sind somit einige Punkte auf der Seite der Ernährung zu beachten. Daher sollte die Umstellung und Therapie durch die Ernährung nicht auf eigene Faust erfolgen, sondern durch die Zusammenarbeit mit einer qualifizierten Ernährungsfachkraft geplant und überwacht werden.
Evidenzlage
Laut aktueller Datenlage lassen sich tumorspezifische Verbesserungen, wie z. B. die Verzögerung des Tumorwachstums, noch nicht quantifizierbar zeigen. Ursächlich hierfür sind die Homogenität bzgl.
Krebstyp, Zeitpunkt der Diagnose, Patienteneigenschaften und die Form der ketogenen Ernährung. Verbesserungen in der Lebensqualität, dem Wohlbefinden und auch verschiedener biometrischer Daten sind nachweisbar (Amanollahi et al. 2023; Lane et al., 2021, Yang et al., 2021; Zhao et al., 2022).
Fazit
Die Ernährung stellt eine wichtige Stellschraube bei der Therapie von Krebs dar. Die ketogene Ernährung kann bei der Krebstherapie unterstützend wirken. Die Zusammenarbeit mit einer qualifizierten Ernährungsfachkraft ist dabei unabdingbar, da die Ernährung genau an die jeweilige Ausgangslage des Patienten bzw. der Patientin angepasst werden muss.
Auszug aus der Literaturliste
Barrea, L., Caprio, M., Tuccinardi, D., Moriconi, E. Di Renzo, L., Muscogiuri, G. et al. (2022). Could ketogenic diet "starve" cancer? Emerging evidence. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 62 (7), 1800-1821.
Lane, J., Brown, N. I., Williams, S., Plaisance, E. P. & Fontaine, K. R. (2021). Ketogenic Diet for Cancer: Critical Assessment and Research Recommendations. Nutrients, 13, 3562.
Yang, Y.-F., Mattamel, P. B., Joseph, T., Huang, J., Chen, Q., Akinwunmi, B. O. et al. (2021). Efficacy of Low-Carbohydrate Ketogenic Diet as an Adjuvant Cancer Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients, 13, 1388.
Für eine vollständige Literaturliste kontaktiere uns bitte hier per Mail.
Diesen Artikel können Sie folgendermaßen zitieren:
Prinzhausen, P. (2024). Ketogene Ernährung bei Krebs. medical fitness and healthcare, 02/2025, 76–78.